Nach der Ermordung des konservativen Aktivisten Charles James Kirk veröffentlichte der US-amerikanische Vizepräsident J. D. Vance auf X einen berührenden Nachruf auf seinen „Freund“, einen Menschen, der lauter, zuverlässig, friedfertig und neugierig gewesen sei. „Charlie war fasziniert von Ideen und stets bereit, zu lernen und seine Meinung zu ändern“, schrieb Vance.
Ein Beitrag von Jürgen Roth

Charlie Kirk, die Februar-Rede auf der Münchner Siko und die linken Bürgerkinder: Wer J. D. Vance verstehen will, muss die „Hillbilly-Elegie“ lesen.
Was mich wütend macht, ist die Fortsetzung des Krieges. (J. D. Vance)
Wie ich war er 2016 Donald Trump gegenüber skeptisch. Wie ich sah er in Präsident Trump den einzigen Mann, der die amerikanische Politik vom Globalismus wegführen konnte, der unser ganzes Leben lang dominiert hatte. Wenn andere recht hatten, lernte er von ihnen. Wenn er recht hatte – und das war meistens der Fall –, war er großzügig. Charlie hätte nie gesagt: „Hab ich’s nicht gleich gesagt?“ Sondern er hat immer gesagt: „Gern geschehen.“ Kirk habe die Diskussion von Ideen geliebt. […] Er begab sich in feindselige Menschenmengen und beantwortete sämtliche Fragen. […] War es eine freundliche Menge, und ein Progressiver stellte unter Buhrufen des Publikums eine Frage, ermahnte er seine Fans, sich zu beruhigen und alle zu Wort kommen zu lassen. Er verkörperte eine grundlegende Tugend unserer Republik: die Bereitschaft, offen zu sprechen und Ideen zu diskutieren.
 Bild: Charlie Kirk am 13. Juni 2025 beim Young Women’s Leadership Summit in Texas (Foto: Gage Skidmore, CC BY-SA 4.0)
Bild: Charlie Kirk am 13. Juni 2025 beim Young Women’s Leadership Summit in Texas (Foto: Gage Skidmore, CC BY-SA 4.0)
Ein wahres Monster also, ein rhetorisch amoklaufender Nazi, mindestens, „ein rechtsradikaler Rassist“, wie eine feindesliebende evangelische Amtspfäffin in der ARD-Sendung Das Wort zum Sonntag diabolisch herumgiftete, in volksgemeinschaftlich dröhnender Übereinstimmung mit jener „Expertennation in Sachen Charlie Kirk“, die ihre „Urteile“ über einen Mann fällte, „den man einige Tage, ja sogar nur wenige Stunden zuvor, noch nicht mal kannte“ (Manova).
In diesen verkommenen, angeblich linksliberalen und linken (Partei-)Kreisen ließ man seinen faschistischen Impulsen freien Lauf. Sie bejubelten und zelebrierten, von Haß durchdrungen, die Tötung eines Menschen, bewarfen ihn posthum mit Dreck, diffamierten und verleumdeten ihn auf eine Weise, an der Julius Streicher seine Freude gehabt hätte.
All diese Charakterruinen, all die faulen und korrupten, vom Staat alimentierten Scheusale hatten nicht einen Fernsehauftritt, nicht eine Debatte, die Kirk an Universitäten geführt hatte, je zur Kenntnis genommen. Einen guten Zusammenschnitt davon lieferte etwa das Nius-Format Gio unzensiert nach. Charles James Kirk war weder homophob noch transphob, er war ein christlicher Humanist, und ein Rassist war er schon gleich gar nicht. „Rasse ist ein soziales Konstrukt, das ich aufbrechen möchte“, hatte er betont, und zumal unter Schwarzen und Hispanics genoß er eine enorme Wertschätzung.
 Bild: Kai Gniffke und Dunja Hayali 2018 in Berlin (Foto: re:publica Germany, CC BY-SA 2.0)
Bild: Kai Gniffke und Dunja Hayali 2018 in Berlin (Foto: re:publica Germany, CC BY-SA 2.0)
Im hiesigen „kalten Bürgerkrieg“ (Manova), der im Netz stante pede abermals ausgebrochen war (und der in näherer Zukunft zu einem heißen mutieren könnte), wollten auch unsere öffentlich-rechtlichen Spitzenjournalisten nicht hintanstehen. Sie logen, daß sich die Balken bogen, ob aus Blödheit oder aus Bosheit bleibe dahingestellt. Neuerlich Berühmtheit erlangte die geringfügig verbrämte Antisemitin Dunja Hayali (Bundesverdienstkreuz am Bande, Goldene Kamera, Theodor-Heuss-Medaille, Toleranzpreis der Evangelischen Akademie Tutzing), die mal den Slogan „Tod Israel!“ als harmlose „Äußerung gegen einen Staat“ abgehakt, mal im ZDF-Morgenmagazin das Gefasel eines Gastes von der „jüdischen Lobby“ mit einem Lächeln quittiert hatte – und nun im heute journal moderierend und, katastrophal ungebildet, wie sie ist, vermutlich vorsätzlich ahnungslos geiferte:
„Daß es nun Gruppen gibt, die seinen Tod feiern, ist mit nichts zu rechtfertigen – auch nicht mit seinen oftmals abscheulichen, rassistischen, sexistischen und menschenfeindlichen Aussagen. Offensichtlich hat der radikalreligiöse Verschwörungsanhänger aber auch genau damit einen Nerv getroffen.“
– was meinte: selber schuld. Die Kugel haste dir verdient.
Hayalis Rufmordstrategie, eine derartige Schweinerei hinter einer ekelhaften, heuchlerischen, perfiden Präambel zu verstecken, schien nicht mehr zu überbieten zu sein – bis die Koryphäe der politischen Expertise, der ingeniöse Durchblicker Elmar Theveßen, bei Herrn Lanz im Gewande des ZDF-Amerikakorrespondenten voller Inbrunst zur Hyperbel griff und Kirk attestierte, „sehr, sehr scharfe Überzeugungen“ vertreten und verbreitet zu haben, unter anderem jene, „daß Homosexuelle gesteinigt werden müssen“.
 Bild: Theveßen im Mai 2024 beim Trump-Prozess (Foto: SWinxy, CC BY-SA 4.0)
Bild: Theveßen im Mai 2024 beim Trump-Prozess (Foto: SWinxy, CC BY-SA 4.0)
Drei – drei! – Wochen später entschuldigte er sich in einem Podcast (und nicht bei Lanz oder im heute journal) für seine infame Denunziation, derweil seine ehemalige Kollegin Petra Gerster, langjährige Moderatorin des heute journals, bei hart aber fair unbeeindruckt von empiriegesättigten Untersuchungen zum bundesdeutschen Medienuniversum tatsächlich zum besten gab:
„Wir haben ein strenges deutsches Medienrecht. Da wäre es undenkbar, daß unsere Tageszeitungen oder die Öffentlich-Rechtlichen eine Lüge veröffentlichen, ohne sofort dafür natürlich zur Rechenschaft gezogen zu werden.“
Daran hatte wohl dito Caren Miosga gerade nicht gedacht, als sie die Co-Vorsitzende der Partei Die Linke, die Krachschachtel Heidi Reichinnek, unwidersprochen herumschwallen ließ, der „ultrarechte“ (Miosga) Charlie Kirk, „diese Person“ (Reichinnek), die keinerlei Mitleid, keinerlei Respekt verdiene, sei von einem Republikaner abgeknallt worden und ein Rassist, ein misogyner Faschist und ein weißer Herrenmensch gewesen.
Man erstarrt staunend vor dem sturheil fortgesetzten Treiben der deutschen „Qual.medien“ (Kay Sokolowsky), die den verrohten Protagonisten der „progressiven“ Szene, die Moral predigen und zugleich der Dehumanisierung geradezu fanatisch Vorschub leisten, permanent die Teppiche ausrollen. Zu Recht vermochte sich das Gerd Buurmann nur noch mit der psychopathologischen Kategorie der kognitiven Dissonanz zu erklären – oder jener der Projektion:
„Nicht die eigene Radikalisierung, nicht die eigene Dämonisierung und Entmenschlichung sind schuld, sondern die andere Seite [ist’s].“
 Bild: Florian Schroeder 2025 in Rust (Foto: Sven Mandel, CC BY-SA 4.0)
Bild: Florian Schroeder 2025 in Rust (Foto: Sven Mandel, CC BY-SA 4.0)
Und es nahm und nahm kein Ende. Der angebliche Kabarettist Florian Schroeder, ein besonders schmieriger, regierungsgeschmierter Repräsentant seiner intellektuell abgewrackten Zunft, erläuterte in dem ihm eigenen degoutanten, herablassenden Tonfall in einem Kommentar auf WDR 2, „Leute wie Trump mit ihrem Haß“ seien für die Tat verantwortlich, ja mehr: „Der Mord an Charlie Kirk hat alles, was die rechtsextreme Szene in diesen Tagen braucht“, er mache „der rechten Szene den Traum möglich, ihn als Märtyrer zu inszenieren“ – um anschließend eine Obszönität aus sich herauszuleiern, die einem die Sprache verschlägt:
„Diese lebensmüden Konservativen wirken wie Leute, die wahrscheinlich auch geweint hätten, wenn das Stauffenberg-Attentat geklappt hätte, unter dem Motto: Aber das Opfer war doch einer, der die Jugend für sich begeistert hat.“
Na endlich: Trump = Kirk = Hitler. Oder doch nicht? Schroeders Schlußannotation:
„Und was wäre, wenn Tyler Robinson ein rechtsextremer Täter wäre, dem Kirk einfach nicht radikal genug war?“
Es ließe sich die Dokumentation derart vollautomatisch emittierten Wahnsinns ad infinitum prolongieren. Die Bildungsstätte Anne Frank schmähte Kirk, sintemalen man da offenbar Hayali geguckt hatte, als „Rechtsextremisten“ und „Menschenfeind“ („Kirk war kein Konservativer, sondern ein Rechtsextremist“; „Man darf keine Menschenfeinde verherrlichen“; „Seine ‚Debate me‘-Veranstaltungen hatten nicht das Ziel, eine offene Debatte zu fördern“; Wer Kirk „jetzt als Kämpfer für die Meinungsfreiheit darstellt, trägt zur Normalisierung seiner rechtsextremen Positionen bei“), und die Zeit, die Hamburger Postille für verarmte Betschwestern aus Blankenese, bestückte zwei Ausgaben hintereinander, die Nummern 40 und 41 des Jahres 2025, mit schwerstbekümmerten Dossiers zum konservativen Terror in den USA.
„Sie nennen es Krieg – Nach dem Mord am Trump-Vertrauten Charlie Kirk radikalisiert sich Amerikas Rechte. Und stößt weiter ins Zentrum der Gesellschaft vor“, dampfte es Bild-kompatibel auf der Titelseite, gefolgt von einem Ganzseiter über den „Kulturkämpfer und Debatten-Unternehmer“ (dergleichen Kameraden gibt’s im von den Grünen gekaperten deutschen Staate selbstverständlich nicht) Charlie Kirk, der ohne jeden Beleg, ohne ein einziges Zitat aus dem Munde des Gottseibeiuns auskam. Man kann dem Leser ein paar Auszüge leider nicht ersparen:
„So etwas hat es noch nicht gegeben: Wenige Tage nach der Ermordung von Charlie Kirk übernimmt der US-Vizepräsident posthum [ein Schlußredakteur hätte „posthum“ als Doppelung gestrichen – J. R.] die Moderation von Kirks Podcast. Aus seinem Büro im Weißen Haus präsentiert J. D. Vance am Montag zwei Stunden lang die Charlie Kirk Show. – Kirk gewann den Ruf eines effektiven Kulturkriegers, der jungen Leuten rechte Politik verkaufen konnte. – Kirk konzentrierte sich von Beginn an vor allem auf Universitäten, die er als linke „Inseln des Totalitarismus“ denunzierte. – Nach seinem Tod wird Kirk von seinen Anhängern als jemand geehrt [nicht doch eher: verehrt? – J. R.], der den Dialog gesucht habe. Doch seine Argumentationstechnik war nicht darauf angelegt, im Streit das bessere Argument herauszupräparieren. Es ging ihm darum, seine Gegner zu überführen. – Kirk filmte und streamte die Debatten [sehr heimtückisch! – J. R.], in denen er vor allem weniger debattenerfahrene Studenten niederwalzte. – Es ließen sich viele weitere Stellen aus Charlie Kirks öffentlichem Leben als Provokateur zusammenstellen.“
Stellen aus einem Leben zusammenstellen? Wo laufen sie denn, diese zusammengestellten Stellen aus einem Leben? In der Zeit halt nicht.
 Bild: J. D. Vance am 17. September 2025 in der Charlie Kirk Show (Foto: Weißes Haus)
Bild: J. D. Vance am 17. September 2025 in der Charlie Kirk Show (Foto: Weißes Haus)
Seite 3: „Über die Toten nur Gutes. Das ist eigentlich nur – „nur“ – ein Sprichwort. Aber in den USA sieht man gerade, wie es zur Staatsräson wird.“ Die USA unter Trump und Vance müssen ein Land von Gnaden des Herrn Goebbels selig sein (Horst-Wessel-Lied, you name it). „Wer Charlie Kirk nicht für einen durchweg feinen Menschen hält, macht sich verdächtig, seinen Tod zu feiern.“ Konservativ-stalinistische Paranoia, ist anzunehmen. Abertausende widerwärtige Videos, in denen die Hinrichtung von Charlie Kirk inflammiert bekreischt wird, dürften Fakes sein.
In der Zeit schrieben einst, da man sie guten Grundes als ein Blatt des praktizierten Pluralismus titulieren konnte, geniale Stilisten wie Hans Magnus Enzensberger, Hermann Peter Piwitt, Wolfgang Pohrt und Uwe Nettelbeck. Heute liest sich die Parolenschleuder wie früher der Spiegel: Jeder Text hat den gleichen, von Ellipsen zerhäckselten Sound (Autorenangaben sind überflüssig), und der in den Haltungsfabriken gefertigte Gesinnungsleierkasten orgelt und orgelt und orgelt:
„Diese unerbittliche Härte, das Freund-Feind-Denken, die Kriegsrhetorik: [Stephen] Millers Rede markiert eine neue Eskalation im Kampf um die amerikanische Demokratie. […] Er instrumentalisiert den Staat gegen Menschen, die er als seine Feinde betrachtet. – Das Attentat haben Trump, sein Vizepräsident J. D. Vance und andere Regierungsmitglieder genutzt, um allen mit Konsequenzen zu drohen, die schlecht über Kirk sprechen. – (Das Ziel: die) „Zersetzung der amerikanischen Demokratie“.“
Sie merken an der Waterkant nichts mehr – und betreiben einen „Journalismus“, den man freundlicherweise unter dem Rubrum „Phrenesie“ abbucht.
J. D. Vance, „der neue Ideologe des Trump-Imperiums“ und „Scharfmacher“, wie es auf arte feinsinnig heißt, hatte am 14. Februar auf der Münchner Kriegskonferenz bekanntlich freihändig eine Rede gehalten, die zu den bedeutendsten politischen Interventionen der vergangenen achtzig Jahre zählt. Das arrogante Bayerische Fernsehen nannte sie abschätzig „eine Moralpredigt“, der anscheinend benebelte ZDF-Reporter Ulf Röller bescheinigte Vance, dieser habe „das Recht des Stärkeren“ propagiert, und der gleich allen anderen verbitterte Hysteriker Boris Pistorius, zu keiner inhaltlicher Kritik fähig, keifte:
„Meine Damen und Herren, das ist nicht akzeptabel!“
 Bild: Vance am 14. Februar 2025 in München (Foto: MSC/Preis, CC BY-SA 4.0)
Bild: Vance am 14. Februar 2025 in München (Foto: MSC/Preis, CC BY-SA 4.0)
Nun, wer meint, eine demokratietheoretische, aus den Quellen der angelsächsischen Aufklärung gespeiste Unterrichtung sei nicht akzeptabel, befleißige sich womöglich in einer stillen Stunde der Benutzung des eigenen Verstandes, und er höre sodann ein bißchen genauer hin (ich übernehme die automatische Übersetzung, leicht korrigiert). Es sei jetzt, hebt Vance an,
„…an der Zeit, daß alle unsere Länder, daß wir alle, die wir das Glück hatten, von unseren jeweiligen Völkern politische Macht übertragen bekommen zu haben, diese weise einsetzen, um das Leben der Menschen zu verbessern.“
Das dürfte ein ethischer Maßstab sein, dem man sich in EU-Europa verpflichtet fühlt. Allein, J. D. Vance nimmt eine Bedrohung wahr, und diese Bedrohung sei keine Drohnenbedrohung. Es ist die Bedrohung, über die ich mir in bezug auf Europa am meisten Sorgen mache, nicht Rußland. Es ist nicht China. Es ist kein anderer externer Akteur. Was mir Sorgen bereitet, ist die Bedrohung von innen, der Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte – von Werten, die es mit den Vereinigten Staaten von Amerika teilt. Ich war erstaunt, daß ein ehemaliger EU-Kommissar kürzlich im Fernsehen verkündete, er sei hocherfreut, daß die rumänische Regierung gerade eine ganze Wahl annulliert habe. Er warnte, daß, sollten die Dinge nicht nach Plan verlaufen, genau dasselbe auch in Deutschland passieren könnte. Diese unbekümmerten Äußerungen sind für amerikanische Ohren schockierend.
Für bürokratische europäische Ohren hingegen sind folgende Worte schockierend, und zwar, weil sie im klassischen ideologiekritischen Sinne der Wahrheit nahekommen:
Wie sich herausstellt, kann man Innovation oder Kreativität nicht verordnen, genausowenig, wie man Menschen zwingen kann, zu denken, zu fühlen oder zu glauben. […] Und wenn ich mir Europa heute anschaue, ist leider manchmal nicht so klar, was mit einigen der Gewinner des Kalten Krieges passiert ist. Ich schaue nach Brüssel, wo EU-Kommissare die Bürger davor warnen, daß sie beabsichtigen, soziale Medien in Zeiten ziviler Unruhen zu schließen, sobald sie etwas entdecken, das sie als „haßerfüllte Inhalte“ einstufen. Oder ich schaue in dieses Land, in dem die Polizei Razzien gegen Bürger durchgeführt hat, die verdächtigt werden, im Rahmen der „Bekämpfung von Frauenfeindlichkeit“ im Internet antifeministische Kommentare online gestellt zu haben – ein Aktionstag. Ich blicke nach Schweden, wo die Regierung vor zwei Wochen einen christlichen Aktivisten wegen seiner Beteiligung an Koranverbrennungen verurteilte, die zum Mord an einem seiner Freunde führten, und wie der Richter in seinem Fall erschreckend feststellte, gewähren die schwedischen Gesetze zum angeblichen Schutz der freien Meinungsäußerung in Wirklichkeit keinen „Freibrief, alles zu tun oder zu sagen, ohne zu riskieren, die Gruppe zu beleidigen, die diesen Glauben vertritt“. Und was vielleicht am meisten Anlaß zur Sorge gibt, ist der Blick auf unsere sehr geschätzten Freunde im Vereinigten Königreich, wo die Abkehr von den Gewissensrechten die Grundfreiheiten des religiösen Großbritanniens ins Fadenkreuz gerückt hat.
Vor etwas mehr als zwei Jahren klagte die britische Regierung Adam Smith Connor, einen 51-jährigen Physiotherapeuten und Veteranen, wegen des abscheulichen Verbrechens an, fünfzig Meter von einer Abtreibungsklinik entfernt gestanden und drei Minuten lang still gebetet zu haben – ohne jemanden zu behindern, ohne mit jemandem zu interagieren, nur still für sich betend. Nachdem ihn britische Polizeibeamte entdeckt hatten und wissen wollten, wofür er bete, antwortete Adam schlicht, daß er für den ungeborenen Sohn bete, den er und seine ehemalige Freundin Jahre zuvor abgetrieben hatten. Die Beamten zeigten sich davon jedoch nicht gerührt. Adam wurde für schuldig befunden […]. Er wurde dazu verurteilt, dem Staat Tausende Pfund an Anwaltskosten zu zahlen. Jetzt wünschte ich, ich könnte sagen, daß dies ein Zufall war, ein einmaliges verrücktes Beispiel dafür, daß ein schlecht geschriebenes Gesetz gegen eine einzelne Person erlassen wurde. Aber nein! Im vergangenen Oktober, vor nur wenigen Monaten, begann die schottische Regierung, Briefe an Bürger zu verteilen, deren Häuser in sogenannten „sicheren Zugangszonen“ lagen, und warnte sie, daß selbst das private Gebet in ihren eigenen vier Wänden einen Gesetzesverstoß darstellen könnte. Natürlich forderte die Regierung die Bürger auf, jeden Mitbürger zu melden, der des Gedankenverbrechens verdächtigt wird.
In Großbritannien und ganz Europa ist die Redefreiheit, so fürchte ich, auf dem Rückzug. Und im Interesse der Komödie, meine Freunde, aber auch im Interesse der Wahrheit, muß ich zugeben, daß die lautesten Stimmen für Zensur manchmal nicht aus Europa, sondern aus meinem eigenen Land kamen, wo die vorherige Regierung Social-Media-Unternehmen bedrohte und einschüchterte, um sogenannte Fehlinformationen zu zensieren – Fehlinformationen wie zum Beispiel die Theorie, das Coronavirus sei wahrscheinlich aus einem Labor in China entwichen. Unsere eigene Regierung ermutigte Privatunternehmen, Menschen zum Schweigen zu bringen, die es wagten, etwas auszusprechen, was sich als offensichtliche Wahrheit herausstellte.
Und wahr ist gleichfalls das, was noch vor fünfzehn Jahren jeder anständige Linke ratifiziert hätte:
„Für viele von uns auf der anderen Seite des Atlantiks sieht es immer mehr so aus, als würden sich alte, festverwurzelte Interessen hinter häßlichen Wörtern aus der Sowjetzeit wie „Fehlinformation“ und „Desinformation“ verstecken, [Interessenvertreter,] denen es einfach nicht gefällt, daß jemand mit einem alternativen Standpunkt eine andere Meinung äußern oder, Gott bewahre, anders wählen oder, noch schlimmer, eine Wahl gewinnen könnte. […] Ich bin zutiefst davon überzeugt, daß es keine Sicherheit gibt, wenn man Angst vor den Stimmen, den Meinungen und dem Gewissen hat, die das eigene Volk leiten. Europa steht vor vielen Herausforderungen, aber die Krise, mit der dieser Kontinent derzeit konfrontiert ist, die Krise, die wir meiner Meinung nach alle gemeinsam erleben, ist eine, die wir selbst verursacht haben. Wenn Sie aus Angst vor Ihren eigenen Wählern handeln, kann Amerika nichts für Sie tun, und es gibt auch nichts, was Sie für das amerikanische Volk tun können, das mich und Präsident Trump gewählt hat. […] Sie können ein demokratisches Mandat nicht gewinnen, indem Sie Ihren Gegner zensieren oder ins Gefängnis stecken, sei es den Oppositionsführer, einen bescheidenen Christen, der in seinem eigenen Haus betet, oder einen Journalisten, der versucht, über Neuigkeiten zu berichten. Man kann auch keine Wahl gewinnen, indem man seine Basiswähler bei Fragen wie der, wer Teil unserer Gesellschaft sein darf, mißachtet. Und von allen Problemen und Herausforderungen, mit denen die hier vertretenen Nationen konfrontiert sind, gibt es meiner Meinung nach nichts Dringenderes als die Massenmigration.“
So. Da war er in den Köpfen der europäischen Herrscher und ihrer medialen Paladine fertiggebaut, der Nazi J. D. Vance, „dieser Mann“, so informiert uns der unermeßliche Spiegel-Podcast Acht Milliarden – Trumps Amerika, „entschlossen scheint, das System, das ihn großgemacht hat, zu zerstören“; dieser Mann, der, verwurzelt in der philanthropischen philosophischen Tradition des angloamerikanischen Pragmatismus (man denke an John Dewey, Russell B. Goodman, Bertrand Russell), in Interviews beständig seinen kategorischen Imperativ hervorhebt: „Man muß die Realität akzeptieren“ (und darob das baerbockige Wertegeschwätz unterlassen). Daher rührt auch das von deutschen, systemisch hypokritischen Kommentatoren immerzu verächtlich gemachte Beharren auf Deals. „Deal“ bedeutet nichts anderes als Vereinbarung, Abmachung – idealiter zum Wohle aller.
Die Realität in ihrer Schwere und in ihrer vielgestaltigen Würde und in ihrer Schönheit und in ihrer Verletzlichkeit zu akzeptieren, das ist ein Zeichen oder Ausdruck von Antibürokratismus und speist den Willen, verkalkte, machtberauschte Eliten, Vorschriftssadisten und Regelfetischisten in die Schranken zu weisen. Die Demut vor Lebenswirklichkeiten bezeugt Empathie, und deshalb sagt Vance in München:
„Ich denke nur, daß den Menschen ihre Heimat wichtig ist. Ihnen sind ihre Träume wichtig. Ihnen sind ihre Sicherheit und ihre Fähigkeit, für sich und ihre Kinder zu sorgen, wichtig, und sie sind klug. Ich denke, dies ist eine der wichtigsten Lektionen, die ich in meiner kurzen Zeit in der Politik gelernt habe, im Gegensatz zu dem, was man ein paar Berge weiter in Davos hören konnte: Die Bürger aller unserer Nationen betrachten sich im allgemeinen nicht als gebildete Tiere oder als austauschbare Rädchen in einer globalen Wirtschaft, und es ist kaum überraschend, daß sie nicht von ihren Führern herumgeschubst oder gnadenlos ignoriert werden wollen. Und es ist die Aufgabe der Demokratie, daß diese großen Fragen an der Wahlurne entschieden werden. […] Was die deutsche Demokratie nicht – was keine Demokratie, weder die amerikanische noch die deutsche oder europäische – überleben wird, ist, Millionen von Wählern zu sagen, daß ihre Gedanken und Sorgen, ihre Hoffnungen, ihre Bitten um Hilfe ungültig oder nicht einmal einer Erwägung wert sind. Demokratie beruht auf dem heiligen Prinzip, daß die Stimme des Volkes zählt. Es gibt keinen Platz für Firewalls. […] An die Demokratie zu glauben, bedeutet zu verstehen, daß jeder unserer Bürger über Weisheit und eine Stimme verfügt.“
Und wie verschlagwortet man und „ordnet“ man solche profan-sakralen Sentenzen ein? Die mit der üblichen Plastikschrottmusik aufgemotzte ZDF-Reportage „Trumps Mann fürs Grobe – Wieviel Macht hat J. D. Vance?“ (2025) demonstriert es mustergültig. „Die alte Ordnung will er umkrempeln“, raunt es – oder: „Vance’ Weg hat ihn ganz an den rechten Rand des politischen Spektrums geführt.“ Warum, wie immer man dazu steht, der rechte Rand teuflisch und der linke Rand heilsbringend sei, hat mir, einem altgedienten Linken, bis heute niemand dargelegt, und weshalb man eine alte Ordnung, die offenbar jene der pseudolinken, staatsgestützten Bevormundung und Enteignung der Arbeiterklasse ist, nicht umkrempeln darf, dürfte evident sein.
Völlig mißraten ist das Stück des ZDF indes nicht. Die Impressionen vom heutigen Middletown in Ohio, wo J. D. Vance aufwuchs, sind beeindruckend, weil bedrückend, und sie deuten den Erfahrungshintergrund an, vor dem Vance sein Ceterum censeo formuliert:
„Der linke kulturelle Fortschrittsglaube macht es normalen Menschen immer schwerer, ihr Leben zu führen. Und darüber bin ich wütend.“
Einem Wort des französischen Soziologen Pierre Bourdieu zufolge kann man seine Klasse bloß verraten. J. D. Vance hat seine Klasse nie verraten. Seine grandiose autobiographische Milieuerkundung Hillbilly-Elegie – Die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise legt davon auf dreihundert Seiten Zeugnis ab, und dort, wo die Staatslinken von „Menschenfeindlichkeit“ und „reaktionärem Gedankengut“ salbadern, entfalten die Motive der Fürsorglichkeit, der stets brüchigen Geborgenheit, der Zugehörigkeit und des lebensgetränkten Eigensinns eine Kraft, die keines von jenen gepamperten Bürgerkindern kennt, die sich in Hamburger, Münchner und Berliner Redaktionen die Welt nach dem Zuschnitt ihrer ausgepolsterten Glaubenssetzkästen zurechtbasteln.
 Bild: J. D. Vance 2023 bei Unterstützern in Ohio (Foto: Senator Vance’s Press Office)
Bild: J. D. Vance 2023 bei Unterstützern in Ohio (Foto: Senator Vance’s Press Office)
Hillbilly-Elegie lebt von einer Balzacschen stofflichen Fülle und erinnert – bei aller Tragik, bei allem Schmerz – in seiner Lakonie und seiner bisweilen wunderbaren ironischen Einfärbung an Castle Freemans fabelhaften Roman Männer mit Erfahrung (Zürich 2016). Vance schreibt die große amerikanische Epopöe vom Landleben, von Armut und Entbehrung, von Landflucht und Industrialisierung, von Glückssuche und Niedergang fort, und er weiß, obwohl Konservativer, was Klassenbewußtsein ist („Es sagt viel über Klassenbewußtsein in meiner Jugend aus, daß meine Freunde gedanklich erst einmal die Kosten des Flugs in den Blick nahmen“). Seine Mutter – hochintelligent und hochsensibel – war drogenabhängig, soff gleich einem Stier, wechselte die Männer wie Handtücher und stürzte das Kind in ein nicht endendes Chaos aus Streitereien, Gewalt, Tränen, Scham und Depression, und seine geliebten Großeltern retteten ihn, durch Strenge, den Sinn für Kampfesmut und individuelle Verantwortung und eine Warmherzigkeit, die jeden gemütskalten und -brutalen Linken beschämen sollte.
Das örtliche Zentrum von Vance’ Entwicklungsroman, einer klassischen, die Härte der Wirklichkeit in sich aufsaugenden linken Erzählung, bildet die heute zerrüttete, zerfallene, zerborstene, zerstörte Stahlarbeiterstadt Middletown im Rust Belt, in einer einst von den Demokraten geprägten Region, in der die Republikaner im vergangenen Jahr allerdings haushoch obsiegten. Früher ein Hort bescheidener Prosperität, über deren Erhalt die Gewerkschaften in Absprache mit den Unternehmern wachten (in der Bundesrepublik nannte man ein solches Modell des gesellschaftlichen Kompromisses „rheinischen Kapitalismus“), sind dort dieser Tage allein schäbige Schemen der Vergangenheit zu gewahren.
„Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, daß Armco, eine Firma, die Stipendien vergab, städtische Parks baute und kostenlose Konzerte veranstaltete, eines Tages nicht mehr da sein könnte,“
schaut Vance auf Zeiten zurück, in denen sich der amerikanische Traum nicht selten noch in der Realität widergespiegelt sah.
Um es deutlich zu sagen: Nein, J. D. Vance, der „kulturelle Emigrant“ aus den Appalachen, ist kein Rassist, er hat als Hinterwäldler habituell induzierte Demütigungen sonder Zahl einstecken müssen und das nicht vergessen. In intellektueller Hinsicht vertritt er libertäre Positionen, in soziologischer urdemokratische, obwohl er sich, was schwer aufzulösen ist, von Peter Thiels Trust protegieren ließ.
Er glaubt nicht, daß der Staat jedes Problem lösen kann, und im Streben nach Erfolg und auf der Suche nach Friedfertigkeit nimmt er den Einzelnen in die Pflicht. Familie, Freundschaft und Liebe sind die einzigen Optionen von Sicherheit inmitten der Wirrnisse der Gefühle und der Verhältnisse, und wer das als christlichen Humbug verhöhnt, mag das tun. Ich bin nicht zum Glauben fähig, und trotzdem läge mir kaum etwas anderes ferner, als die Botschaft der Bergpredigt in den Schmutz zu ziehen.
Einmal spricht J. D. Vance von „emotionaler Armut“. An anderer Stelle heißt es:
„Der Zynismus der Menschen ging über die materiellen Nöte hinaus; er hatte etwas beinahe Spirituelles, etwas, das viel tiefer reichte als eine normale Rezession.“
Vielleicht wäre hier der Begriff des Nihilismus angebracht, ich weiß es nicht. Oder der der Ibsenschen Lebenslüge:
Wir reden ständig über den Wert harter Arbeit und machen uns weis, daß wir nur deshalb nicht arbeiten, weil wir unfair behandelt werden: weil Obama die Kohlebergwerke geschlossen hat oder weil alle Stellen nach China abgewandert sind. Das sind die Lügen, die wir uns selbst erzählen, um unsere kognitive Dissonanz aufzulösen – die Abkopplung zwischen der Welt, die wir vor Augen haben, und den Werten, die wir predigen.
Ich bin mit Klaus Bittermann befreundet gewesen. Ich habe in seinem Verlag, in der Edition Tiamat, etliche Bücher herausgegeben. Klaus Bittermann hatte Hillbilly-Elegie 2017 in der taz gepriesen und zu Recht mit Didier Eribons Rückkehr nach Reims verglichen. 2024, nach Vance’ Nominierung zum Running Mate von Donald Trump, widerrief er ebenda sein Urteil im Gestus einer opportunistisch-maoistischen Selbstunterwerfung, die sein gesamtes Buchprogramm diskreditierte, und pinselte hin:
„Liest man die Hillbilly-Elegie vor dem Hintergrund der Karriere noch einmal, fällt einem auf, daß der Bucherfolg auf einer gewissen Sozialromantik beruht, die durchaus mit Vance’ reaktionären Positionen als Trump-Vize in Einklang gebracht werden kann. […] Vance hegt für die Abgehängten also doch nicht Sympathien, wie er in seinem Buch immer wieder behauptet, sondern nur, wenn sie sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Nicht sehr einfühlsam schreibt er: „Die Leute an Orten wie Middletown reden ständig darüber, wie hart sie arbeiten. Man kann durch die Stadt gehen, in der dreißig Prozent der jungen Männer weniger als zwanzig Stunden in der Woche arbeiten, und keinen einzigen Menschen finden, der sich seiner eigenen Faulheit bewußt ist.“ […] Faulheit oder Unlust sind jedoch keine Kategorien, mit der sich eine rationale Politik begründen läßt, weil man damit ganz schnell bei Nazibegriffen wie „Sozialschmarotzer“ landet, bei Fremdenphobie und der Aussortierung „unwerten Lebens“. […] Nach seiner Wandlung zum Trump-Fan und Ernennung zum Vizepräsidentschaftskandidaten ist man versucht, vielleicht doch eher von einer mißlungenen Resozialisierung zu sprechen, weil er sich letztlich doch nie von seiner Redneck-Vergangenheit gelöst hat und immer noch so denkt wie der White Trash.“
White Trash? Abschaum? Der nie den Weg zur linken Erlösung gefunden hat?
Dem weißen Quatschschädel Klaus Bittermann sei wenigstens eine Anmerkung aus den Kommentarspalten der taz entgegengehalten, in der kundgetan ward, daß sich „jetzt“ ehemalige Panegyriker in Sachen Hillbilly-Elegie offenbar „in der Pflicht [sehen], dringend ein paar Prisen Faschismus darin zu entdecken“.
Auf Seite 248 notiert J. D. Vance: „Manchmal ist es wichtiger, Glück zu haben, als gut zu sein.“
They call it Kontingenz. Faschistische Dreckswelt, aber echt.
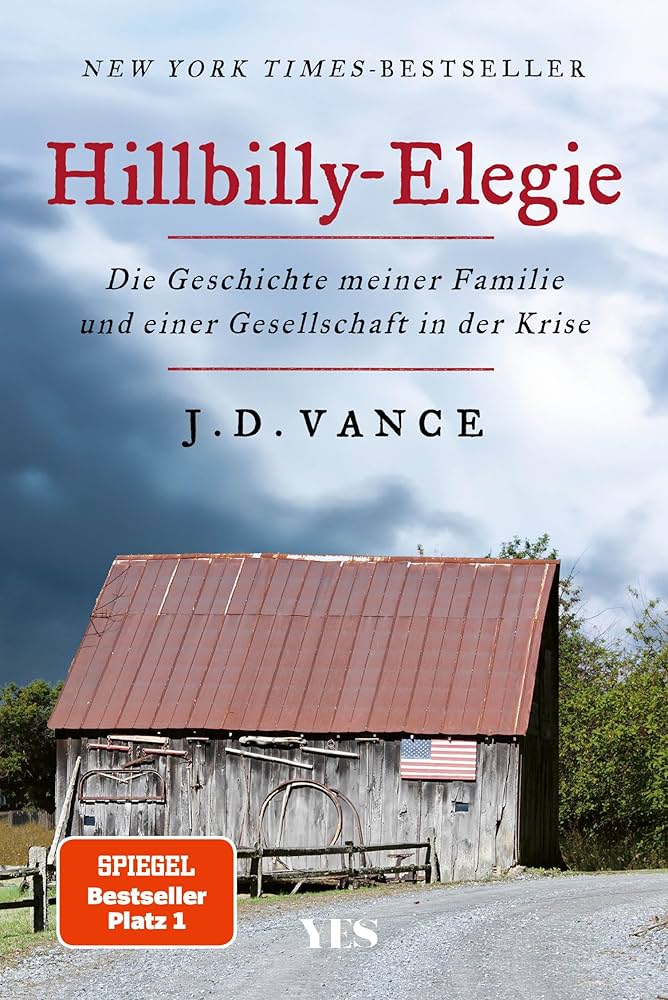
J. D. Vance: Hillbilly-Elegie. Die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise. München: Yes 2024, 304 Seiten, 18 Euro.
Quelle: https://www.freie-medienakademie.de/medien-plus/einige-satze-uber-die-welt
Jürgen Roth, Jahrgang 1968, ist Schriftsteller. In seinen Publikationen geht es neben der Politik um Fußball und den sonstigen Wahnsinn des Alltags.
Disclaimer: Berlin 24/7 bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion Berlin 24/7 widerspiegeln. Wir bemühen uns, unterschiedliche Sichtweisen von verschiedenen Autoren – auch zu den gleichen oder ähnlichen Themen – abzubilden, um weitere Betrachtungsweisen darzustellen oder zu eröffnen.






