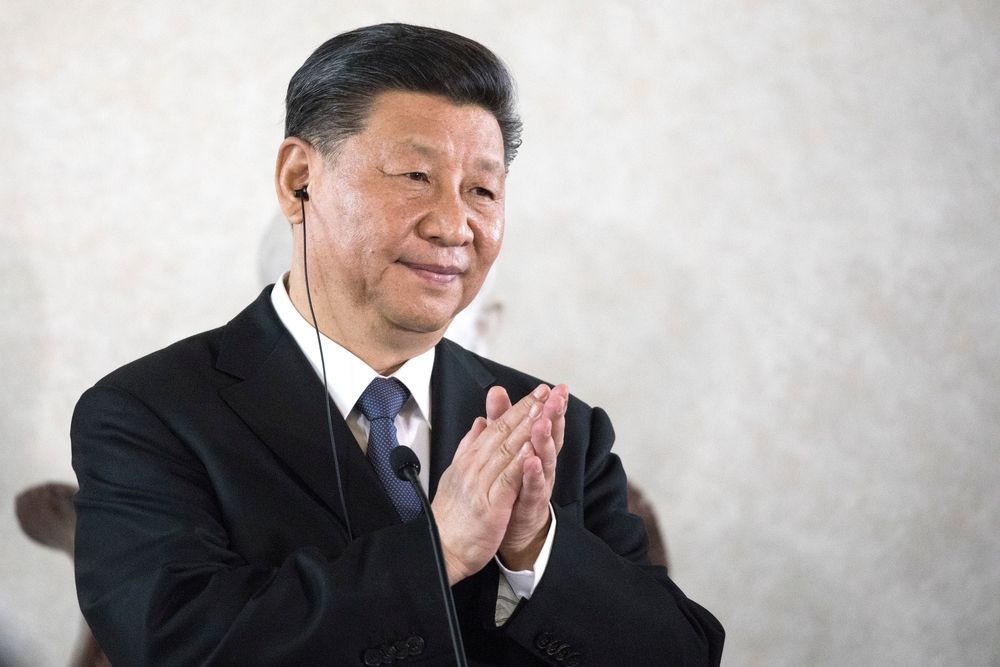Es ist an der Zeit, mit der Illusion aufzuräumen, Europäer und Amerikaner lebten in ein und derselben Welt oder besäßen gar ein gemeinsames Weltbild. In der alles entscheidenden Frage der Macht – in der Frage nach der Wirkungskraft, der Ethik, der Erwünschtheit von Macht, gehen die europäischen und amerikanischen Interessen auseinander. Europa wendet sich von der Macht ab oder es bewegt sich, anders gesagt, über diese hinaus.
Ein Essay von Robert Kagan

Es betritt eine in sich geschlossene Welt von Gesetzen, Regelungen, transnationalen Verhandlungen und transnationaler Zusammenarbeit, ein post-historisches Paradies des Friedens und des Wohlstands, das der Verwirklichung von Kants „ewigem Frieden“ gleichkommt. Dagegen bleiben die USA der Geschichte verhaftet und üben Macht in der Hobbesschen Welt aus, in der auf internationale Regelungen und Völkerrecht kein Verlass ist und in der wirkliche Sicherheit sowie die Förderung und Verteidigung einer liberalen Ordnung nach wie vor von Besitz und Einsatz militärischer Macht abhängen. Aus diesem Grund verstehen sich Amerikaner und Europäer in wichtigen strategischen Fragen heute immer weniger. Und dieser Zustand ist nicht vorübergehender Natur, nicht lediglich auf eine einzelne US-Wahl oder ein einzelnes Katastrophenereignis zurückzuführen. Die Ursachen für die transatlantischen Meinungsverschiedenheiten liegen tief und werden nicht so schnell beseitigt werden können. Insofern es um das Setzen nationaler Prioritäten, die Einschätzung von Bedrohungen, die Gestaltung und Durchsetzung von Außen- und Verteidigungspolitik geht, haben die Wege der Vereinigten Staaten und Europas sich getrennt.
In Europa ist man sich der wachsenden Unterschiede stärker bewusst, vielleicht, weil man sie dort stärker fürchtet. Europäische Intellektuelle zeigen sich nahezu einmütig überzeugt davon, dass Amerika und Europa keine gemeinsame „strategische Kultur“ mehr haben. Die USA, so argumentieren viele Europäer, nähmen schneller Zuflucht zu militärischer Gewalt und brächten weniger Geduld für diplomatische Bemühungen auf. Für Amerikaner sei die Welt in Gut und Böse eingeteilt. In der Auseinandersetzung mit Gegnern stellten sie Zwang über Überzeugungsarbeit, Strafmaßnahmen über Anreize zu besserem Verhalten, die Peitsche über das Zuckerbrot. Die Amerikaner seien stets bestrebt, internationale Fragen ein für alle Mal zu klären. Ihnen liege daran, dass Probleme gelöst, Bedrohungen beseitigt werden. Und natürlich tendieren die Amerikaner zunehmend zu Alleingängen in internationalen Angelegenheiten. Sie sind weniger darauf eingestellt, über internationale Organisationen wie die UN zu handeln, weniger geneigt, mit anderen Staaten zur Erreichung gemeinsamer Ziele zusammenzuarbeiten, betrachten das Völkerrecht skeptischer und sind durchaus bereit, auch außerhalb seiner engen Grenzen zu operieren, wenn sie es für erforderlich oder nützlich halten.
Dagegen machen die Europäer beharrlich geltend, sie selbst gingen Probleme differenzierter und abgewogener an. Sie versuchten, andere behutsam und auf indirekte Weise zu beeinflussen. Sie seien geduldiger, nähmen auch einmal einen Fehlschlag in Kauf. Sie zögen Überzeugungsarbeit jedwedem Zwang vor. Sie setzten stärker auf das Völkerrecht und die Meinung der internationalen Gemeinschaft, wenn es um die Klärung strittiger Fragen gehe. Sie bemühten sich, die Staaten über Wirtschafts- und Handelsbeziehungen enger aneinander zu binden. Dieses europäische Porträt der beiden Seiten ist natürlich eine Karikatur.
Aber sie enthält bei aller Übertreibung und Simplifikation ein Körnchen Wahrheit: Die USA und Europa sind heute grundverschieden. Powell und Rumsfeld haben mehr gemein als Powell und Hubert Védrine [der ehemalige französische Außenminister] oder auch als Powell und Jack Straw. Im Hinblick auf den Einsatz von militärischer Gewalt haben die amerikanischen Demokraten mehr mit den Republikanern gemein als mit den meisten europäischen Sozialdemokraten. Worauf sind diese Unterschiede zurückzuführen?
Sie liegen, anders als viele Europäer glauben, nicht in den Nationalcharakteren begründet. Schließlich ist das, was die Europäer heute als ihre friedlichere strategische Kultur betrachten, recht neu. Es handelt sich um eine allmähliche Abkehr von der Kultur, die in Europa jahrhundertelang und zumindest bis zum Ersten Weltkrieg dominiert hat. Die europäischen Regierungen – und Völker –, die sich in diesen Krieg stürzten, glaubten an Machtpolitik [i. Orig. deutsch]. Zwar lassen sich die Wurzeln der derzeitigen europäischen Weltsicht und auch der EU bis in die Aufklärung zurückverfolgen, doch Europas Machtpolitik hielt sich nicht an die Entwürfe der Philosophen und Physiokraten.
Auch haben die USA nicht von jeher bei der Gestaltung internationaler Beziehungen auf militärische Gewalt gesetzt, dem Völkerrecht die kalte Schulter gezeigt und ganz offen zum Unilateralismus tendiert. Die Amerikaner sind ebenfalls Kinder der Aufklärung und waren in den frühen Jahren der Republik aufrichtigere Verfechter ihrer Ideen. Im 18. und 19. Jahrhundert klangen Amerikas Staatsmänner ganz ähnlich wie die europäischen Staatsmänner von heute, die Handelsbeziehungen und Völkerrecht als die Mittel preisen, die bei internationalen Auseinandersetzungen über die Anwendung militärischer Gewalt zu stellen seien.
Die jungen USA spielten zwar ihre die Welt in Gut und Böse eingeteilt. In der Auseinandersetzung mit Gegnern stellten sie Zwang über Überzeugungsarbeit, Strafmaßnahmen über Anreize zu besserem Verhalten, die Peitsche über das Zuckerbrot. Die Amerikaner seien stets bestrebt, internationale Fragen ein für alle Mal zu klären. Ihnen liege daran, dass Probleme gelöst, Bedrohungen beseitigt werden. Und natürlich tendieren die Amerikaner zunehmend zu Alleingängen in internationalen Angelegenheiten. Sie sind weniger darauf eingestellt, über internationale Organisationen wie die UN zu handeln, weniger geneigt, mit anderen Staaten zur Erreichung gemeinsamer Ziele zusammenzuarbeiten, betrachten das Völkerrecht skeptischer und sind durchaus bereit, auch außerhalb seiner engen Grenzen zu operieren, wenn sie es für erforderlich oder nützlich halten.
Dagegen machen die Europäer beharrlich geltend, sie selbst gingen Probleme differenzierter und abgewogener an. Sie versuchten, andere behutsam und auf indirekte Weise zu beeinflussen. Sie seien geduldiger, nähmen auch einmal einen Fehlschlag in Kauf. Sie zögen Überzeugungsarbeit jedwedem Zwang vor. Sie setzten stärker auf das Völkerrecht und die Meinung der internationalen Gemeinschaft, wenn es um die Klärung strittiger Fragen gehe. Sie bemühten sich, die Staaten über Wirtschafts- und Handelsbeziehungen enger aneinander zu binden. Dieses europäische Porträt der beiden Seiten ist natürlich eine Karikatur.
Macht gegenüber schwächeren Völkern auf dem nordamerikanischen Kontinent aus, doch als es darum ging, sich mit den europäischen Riesen anzulegen, behaupteten sie, der Macht abzuschwören, und verurteilten die Machtpolitik der europäischen Staaten als atavistisch. Zwei Jahrhunderte später haben Amerikaner und Europäer die Plätze – und Perspektiven – getauscht. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass sich in diesen zweihundert Jahren, vor allem aber in den letzten Jahrzehnten, die Macht entscheidend verlagert hat. Als die USA schwach waren, verfolgten sie die Strategien der Schwachen; nun, da sie mächtig sind, benehmen sie sich auch wie ein mächtiger Staat. Als die europäischen Großmächte stark waren, glaubten sie an Stärke und Kriegsruhm. Heute sehen sie die Welt mit den Augen schwächerer Mächte. Diese ganz unterschiedlichen Blickwinkel – aus einer Position der Schwäche oder der Stärke – haben naturgemäß unterschiedliche strategische Einschätzungen hervorgebracht, unterschiedliche Beurteilungen von Bedrohungen und den richtigen Mitteln, diesen zu begegnen, ja sogar unterschiedliche Interessenkalküle. Aber darin finden wir nur einen Teil der Antwort. Denn zugleich mit diesen natürlichen Konsequenzen des transatlantischen Machtgefälles zeigt sich ein tiefer ideologischer Graben. Europa hat auf Grund der einzigartigen historischen Erfahrung, die seine Geschichte während des letzten halben Jahrhunderts darstellt, einen Werte- und Prinzipienkatalog hinsichtlich des Nutzens und der Ethik von Machtpolitik entwickelt, der sich von den Werten und Prinzipien der Amerikaner unterscheidet. Denn letztere haben diese historische Erfahrung nicht gemacht. Wenn die strategische Kluft zwischen den Vereinigten Staaten und Europa heute größer denn je erscheint und sich mit beunruhigender Geschwindigkeit weiter öffnet, so deshalb, weil die sachlichen und die ideologischen Gegensätze einander wechselseitig verstärken. Die daraus erwachsenden Spaltungstendenzen könnten sich als irreversibel erweisen.
Europa verlor mit dem Ende des Kalten Krieges endgültig seine zentrale strategische Position, doch dauerte es noch einige Jahre, bis die Illusion von der Weltmachtrolle endgültig schwand. Während der 90er Jahre behielt Europa auf Grund des Krieges auf dem Balkan und der NATO-Erweiterung sowohl für die Europäer als auch für die Amerikaner seine strategische Bedeutung. Damals richtete sich die Hoffnung auf das „neue Europa“. Durch die Verschmelzung zu einer einzigen politischen und ökonomischen Einheit – in der Konsequenz des Maastrichter Vertrags von 1992 – könne, so hofften viele, Europa seine alte Größe in einer neuen Form wiedererlangen. „Europa“ würde die neue Supermacht, nicht nur auf wirtschaftlichem und politischem, sondern auch auf militärischem Gebiet. Es würde sich um Krisen auf dem europäischen Kontinent wie den Balkankonflikt kümmern und erneut eine Weltrolle spielen. In den 90er Jahren konnten die Europäer selbstbewusst behaupten, die Macht eines vereinten Europa würde die „Multipolarität“ wiederherstellen, die durch den Kalten Krieg und seine Folgen verloren gegangen war. Und die meisten Amerikaner pflichteten – wenn auch mit gemischten Gefühlen – bei, dass der Supermacht Europa die Zukunft gehöre. Doch die europäischen Ambitionen erfüllten sich nicht, die amerikanischen Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet. Es kam in den 90er Jahren nicht zu dem erwarteten Aufstieg Europas zur Supermacht, vielmehr ließ sich dessen relative Schwäche nicht mehr verbergen. Der Balkankonflikt zu Beginn des Jahrzehnts offenbarte die militärische Unfähigkeit und politische Konfusion Europas; der Kosovokonflikt am Ende des Jahrzehnts machte die Kluft deutlich, die in Hinblick auf Militärtechnologie und die Fähigkeit zur modernen Kriegsführung zwischen Amerika und Europa bestand und die während der kommenden Jahre nur noch breiter werden würde. Zu erwarten, Europa könne erneut Großmachtstatus erlangen, war unrealistisch, solange die Europäer sich nicht entschlossen, finanzielle Mittel in größerem Maßstab von sozialen in militärische Programme umzuschichten. Und dazu waren sie ganz offensichtlich nicht bereit. Die Europäer waren nicht nur nicht willens, die nötigen Mittel zur Projektion militärischer Macht in Gebiete außerhalb Europas aufzubringen; nach dem Kalten Krieg zeigten sie sich nicht einmal dazu bereit, so viel Geld für ihre Streitkräfte auszugeben, dass sie wenigstens kleinere Militäraktionen auf ihrem eigenen Kontinent ohne amerikanische Hilfe durchführen konnten.
Auch schien es keine Rolle zu spielen, ob man von der europäischen Öffentlichkeit verlangte, Geld zur Stärkung der NATO oder für eine unabhängige europäische Außen- und Verteidigungspolitik auszugeben. Die Antwort war stets dieselbe. Anstatt den Zusammenbruch der Sowjetmacht als Chance zu begreifen, weltweit die Muskeln spielen zu lassen, nutzten die Europäer die Gelegenheit, um eine ansehnliche Friedensdividende einzustreichen. Im Durchschnitt sanken die europäischen Verteidigungsbudgets nach und nach auf unter 2% des BIP, und die militärische Schlagkraft Europas fiel daher während der 90er Jahre immer weiter hinter die der Vereinigten Staaten zurück. Die zunehmend ungleiche Verteilung der Macht diesseits und jenseits des Atlantiks musste unvermeidlich zu divergierenden strategischen Vorstellungen führen. Schon während des Kalten Krieges hatten Amerikas militärische Vorherrschaft und Europas relative Schwäche zu Misshelligkeiten geführt. Gaullismus, Ostpolitik [ i. Orig. deutsch], die europäischen Unabhängigkeitsund Einheitsbestrebungen waren nicht allein Ausdruck eines europäischen Strebens nach Ansehen und Handlungsfreiheit. Sie spiegelten auch die europäische Überzeugung wider, die Haltung der USA im Kalten Krieg sei zu sehr auf Konfrontation angelegt, zu militaristisch und zu riskant. Die Europäer glaubten, besser zu wissen, wie man mit den Sowjets zurechtkommt: nämlich durch Engagement und Lockmittel, durch ein Netz wirtschaftlicher und politischer Bindungen, durch Nachsicht und Ausdauer. Diese Auffassung war durchaus legitim und wurde von vielen Amerikanern geteilt. Doch sie offenbarte auch die Schwäche Europas im Vergleich zu den USA, die geringeren militärischen Optionen, die Europa zur Verfügung standen, und seine größere Verwundbarkeit gegenüber einer mächtigen Sowjetunion. In sie mag auch die Erinnerung des alten Kontinents an die europäischen Kriege eingegangen sein. Amerikaner, die mit den Feinheiten politischer Entspannung nicht vertraut waren, betrachteten Europas Vorgehen als eine Form von Beschwichtigungspolitik, eine Rückkehr zur Mentalität der 30er Jahre. Aber das Wort Beschwichtigung klingt in den Ohren derer, die auf Grund der eigenen Schwäche kaum attraktive Alternativen haben, nicht unanständig. Sie halten Beschwichtigungspolitik für eine raffinierte Strategie.
Der 2. Teil erscheint in der kommenden Woche Freitag zum Thema: Die Psychologie der Macht und der Schwäche
Das Essay erschien unter dem Titel „Power and Weakness“ zuerst in der „Policy Review“, einer Zweimonatszeitschrift der den amerikanischen Republikanern nahestehenden Hoover Institution (Nr. 113, Mai/Juni 2002). Robert Kagans streitbare Thesen haben ein wachsendes publizistisches Echo auch in der Bundesrepublik gefunden und wurde in deutscher Sprache der Redaktion „Blätter für deutsche und internationale Politik 10/2002″ zur Verfügung gestellt. Übersetzung und Kürzung besorgten Ingrid Rein und die „Blätter“-Redaktion. Quelle: Blätter für deutsche und internationale Politik 10/2002