Ist der Berufstand des Historikers wegen der KI in Gefahr? Schaut man auf die deutschen Vertreter dieser Zunft, könnte man schlussfolgern: Die KI wäre ein echter Fortschritt.
Ein Beitrag von Roberto J. De Lapuente
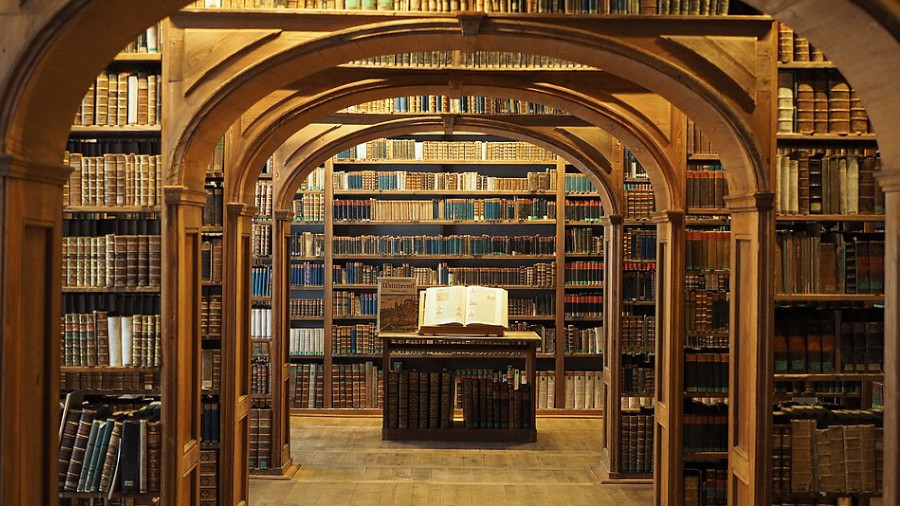
Künstliche Intelligenz (KI) mal wieder. Das ist das Thema, das die Seiten füllt, wenn Journalisten gar nichts mehr einfällt. Dann beschwören sie den Untergang der alten Kultur. Natürlich ist auch viel eigene Angst mit am Werk, schließlich könnte ihre Arbeit bald überflüssig werden. Wer mit KI arbeitet, dem wird schnell klar: Das Ding kann keine Artikel schreiben. Die Sätze wirken seltsam oberflächlich – was natürlich nicht unbedingt störend sein muss für eine Leserschaft der Zukunft, die tiktokgeschädigt gar nicht mehr in der Lage dazu sein dürfte, komplexere Satzkonstruktionen zu erfassen.
Und so las man auch neulich in der Frankfurter Allgemeinen von der KI, besser gesagt von einer Studie Microsofts, die vermeintlich eruiert hat, welche Berufe künftig wegfallen dürften: Dolmetscher, Historiker und Unternehmensberater soll es demnach treffen. Natürlich könnte man als Journalist nun Skepsis an den Tag legen, wenn ein Unternehmen, das in KI macht, eine Studie zur KI präsentiert. Aber wir sind in Deutschland, skeptische Journalisten sind nicht gerne gesehen und machen sich verdächtig. Wenn KI dereinst den Job dieser Gilde übernimmt, wird es so sein wie es schon lange war: Eine zur Skepsis unfähige Maschine übernimmt dann den Job, den vorher zur Skepsis nicht erzogene Menschen verrichtet haben.
Vergangenheit als Waffe
Historiker soll es also auch treffen. Die Frage ist nun wirklich, welche Art von historischer Arbeit KI leisten kann, die irgendeinen Nutzen für die Allgemeinheit hat. Klar, sie kann sich die Daten zu Ereignissen herausfiltern. Aber irgendwer muss sie doch eingetippt, irgendjemand muss doch Interviews mit Zeitzeugen geführt haben. Die KI bedient sich an der Datenlage, die vorliegt. Sie mag zwar fähig sein, Schlüsse aus dem, was ihr verfügbar ist, zu ziehen. Aber das was ihr vorgelegt werden kann, muss jemand erarbeitet haben, der mit denen sprach, die dabei waren, die es erlebt haben. Anzunehmen, dass KI das Fach übernimmt, mag für Microsoft eine attraktive Vorstellung sein. Vielleicht imaginiert man sich in der Vorstandsetage eine Gesellschaft, in der das Unternehmen die Geschichte so lehrt, wie es die Vorstände für richtig halten. Denn wer die Geschichtsschreibung kontrolliert, der kontrolliert auch immer die gegenwärtige Macht.
Wenn man auf die deutschen Verhältnisse blickt, fragt man sich mit einiger Berechtigung, ob denn die Übernahme der Geschichtswissenschaften durch eine Maschine, nicht mehr Chancen als Risiken berge. Die deutsche Historikerzunft hat ein Problem: Viele, besonders jene mit Öffentlichkeit, begreifen sich mehr und mehr als Aktivisten. Es sind politische und auch ideologische Historiker, die ihr Wissen um die Vergangenheit einsetzen, um heute Politik zu steuern. Einige in Deutschland namhafte Vertreter dieses Standes treten nicht etwa schlicht in ihrer Kategorie auf, sie setzen sich als Experten für die heutige politische Situation in Szene. Speziell wenn es um den Ukrainekrieg geht, wissen sie gemeinhin, was zu tun und zu unterlassen sei. Die Vergangenheit, die sie sicher gut kennen in ihrem jeweiligen Gebiet, wird zur Zukunftsempfehlung – teils durchsetzt mit grobmotorischer Haltung, brachialer Sprache und frei von neutraler Darlegung. Sie fungieren nicht als Experten, die die Gegenwart erklärbar und nachvollziehbar machen sollen, sondern als moralinsaure Befürworter einer Richtlinie, die die Zukunft beim Schopf packen soll: Wenn nötig mit der Eskalation des Krieges in der Ukraine und damit auch mit einem Waffengang.
Natürlich erlaubt ein hoher Wissensstand über das, was einst war, auch die Zustände in der Gegenwart besser begreifen zu können – das Gewesene zu kennen und sichtbar zu machen, gibt Stabilität und auch Orientierung. Die Aufgabe der Geschichtswissenschaft ist es natürlich, das Vergangene transparent zu machen – immer auch in der Hoffnung, dass sich daraus Lehren für die Gegenwart ableiten lassen. Aber Historiker kümmern sich um das was war und nicht um das, was sein könnte. Genau das tun diese Vertreter dieser »neuen deutschen Schule« aber. Sie geben sich öffentlichkeitswirksam so, als könnten sie aus der Exegese des Gewesenen ableiten, was in der Zukunft geschehen wird – oder zumindest, was dort geschehen müsste.
Historiker als Orakel
Der derzeit bekannteste Historiker, auch weil er mit einem suspekten Friedenspreis prämiert wird, ist Karl Schlögel. Er weiß nicht nur, was war – er erklärt auch, was sein wird. Unter anderem spricht er immer wieder vom imperialen Anspruch Russlands, der auch Deutschland gefährde. Dass also die Russen ante portas stehen werden, geht auch auf ihn zurück. Belege dafür gibt es keine, US-Dienste schließen eine solche Option schon seit langem kategorisch aus. Als der Ukrainekrieg begann, vernahm man bereits, dass die Russen die Ukraine nun überrennen und dann weiter nach Westen ziehen würden. Dreieinhalb Jahre später ist davon nichts zu sehen. Schlögel interessiert sich aber erstaunlich wenig – jedenfalls bei seinen öffentlichen Auftritten – für das Gewesene: Wenn es um die geopolitischen Entwicklungen in Osteuropa geht, bleibt er verhalten. Stichwort: Vorgeschichte.
Nachdem an dieser Stelle ein Artikel zu Schlögel und diesen unsäglichen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels zu finden war, stürzten sich recht schnell der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk und die Historikerin Anna-Veronika Wendland vom Herder-Institut auf den Artikel. Wendland machte dabei klar: Wer »Vorgeschichte« auch nur sagt, macht sich sofort verdächtig – denn: Dieser Begriff sei »inzwischen zum Synonym für die russische Präventivkriegslüge verkommen«. Egal wie man zu diesem Ukrainekrieg nun steht, eines sollte doch in jedem Falle unzweifelhaft sein: Es geschieht in dieser Welt nichts einfach so, alles hat einen Vorlauf, baut auf das Gewesene auf. Für einen Historiker sollte doch in jedem Fall eine zentrale Frage gelten: Wie kam es zu dem Ereignis? Was führte dort hin? Und vielleicht auch, wenn man spekulativer sein möchte als Historiker: Musste es so enden? Gab es Abzweigungen, die verpasst wurden?
Und was wusste der schon genannte Ilko-Sascha Kowalczuk auf den Artikel anzumerken? Er teilte den Artikel auf X und schrieb drunter: »Zeigt diesen Kremlknilchen, dass wir mehr, lauter und besser sind!« Der Historiker als Aktivist: Da muss man sich in der Tat Sorgen machen – und darf getrost auf die Hoffnung setzen, dass KI diesen Beruf übernimmt. Denn die KI mag vielleicht keine Tiefe haben, wenn sie auf staatstragend programmiert macht – doch dass sie sich zum Schlachtenbummler des Zeitgeistes in einer derart plumpen Weise herabwürdigen lässt, ist ziemlich ausgeschlossen. Gesicht zeigen, wie es die menschlichen Zertreter dieser Zunft tun, ist für eine KI vielleicht gar kein Thema – es heißt ja Geschichtswissenschaft und nicht Gesichtswissenschaft.
Gestern, heute, morgen
Weniger extrovertiert ist ein anderer dieser Zunft in Deutschland: Sören Neitzel. Sicher, er ruft seine Fanboys nicht dazu auf, es irgendwelchen Knilchen zu zeigen. Anders als Kowalczuk scheint ihm die Stigmatisierung politisch Andersdenkender nicht das größte Anliegen zu sein. Aber warum muss er, als Historiker, der er nun mal ist, sich publikumswirksam einen Verteidigungsminister wünschen, der »handlungsfähiger« sei. Das ist schon eine Weile her, mittlerweile dürfte er zufrieden sein, Pistorius wird ihm wohl eher gefallen. Neitzel sprach sich früh für Kriegstüchtigkeit aus. Das mag ja seine private Haltung sein – aber wenn er ein Studio betritt, dann doch wohl, weil er exponierter Historiker ist. Wann hat das angefangen, dass Menschen, die in den Geschichtswissenschaften tätig sind, plötzlich zu ausgewiesenen Fachleuten für die Fragen der Zukunftsgestaltung wurden?
Und schlimmer noch: Wer kam denn auf die Idee, Historiker so in der Öffentlichkeit zu positionieren, dass sie die Gegenwart so aufhetzen, dass am Ende nicht Erkenntnisgewinn steht, sondern die Vernebelung. Geschichtswissenschaften haben eigentlich den Anspruch, Vergangenes aus dem Nebel zu holen – nicht es darin noch tiefer zu verbergen, indem man zum Specialagent für Gegenwarts- und Zukunftsangelegenheiten wird. Es wäre besser, wenn Historiker mehr von gestern und weniger von heute oder gar morgen wären.
Nein, man sollte die KI in der Tat auch in den Geschichtswissenschaften nicht fürchten. Was die Protagonisten des Faches im zeitgenössischen Deutschland anzubieten haben, dürfte die Maschine mit mehr Würde und mehr Anstand leisten können. Wird deren Geschichtsbild gefärbt sein? Wird sie mit Prämissen an die Analyse gehen? Natürlich! Aber es ist ja nicht so, dass Menschen nicht an denselben Defiziten leiden. Das taten Historiker zu allen Zeiten, Objektivität gab es selten. Aber so übergriffig wie es einige heutige Leutchen sind, die sich als Historiker schimpfen, war es selten. Man muss die KI also als Chance betrachten – in einer Gesellschaft voller Fachleute, die ihren Auftrag verfehlen, ist die Maschine, die ihren Auftrag vorgeprägt und daher schlecht ausführt, fast schon ein bisschen Fortschritt.

Roberto J. De Lapuente, Jahrgang 1978, ist gelernter Industriemechaniker und betrieb acht Jahre lang den Blog »ad sinistram«. Von 2017 bis 2024 war er Mitherausgeber des Blogs »neulandrebellen«. Er war Kolumnist beim »Neuen Deutschland« und schrieb regelmäßig für »Makroskop«. Seit 2022 ist er Redakteur bei »Overton Magazin«. De Lapuente hat eine erwachsene Tochter und wohnt in Frankfurt am Main.
Mehr Beiträge von Roberto De Lapuente →
Disclaimer: Berlin 24/7 bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion Berlin 24/7 widerspiegeln. Wir bemühen uns, unterschiedliche Sichtweisen von verschiedenen Autoren – auch zu den gleichen oder ähnlichen Themen – abzubilden, um weitere Betrachtungsweisen darzustellen oder zu eröffnen.







