Es mag viele Gründe geben, weswegen man an den Niedergang westlicher Gesellschaften glauben mag. Der wesentliche Grund, der einem vom Schlimmsten ausgehen lässt, ist jedoch – die Doppelmoral!
Ein Beitrag von Roberto J. De Lapuente
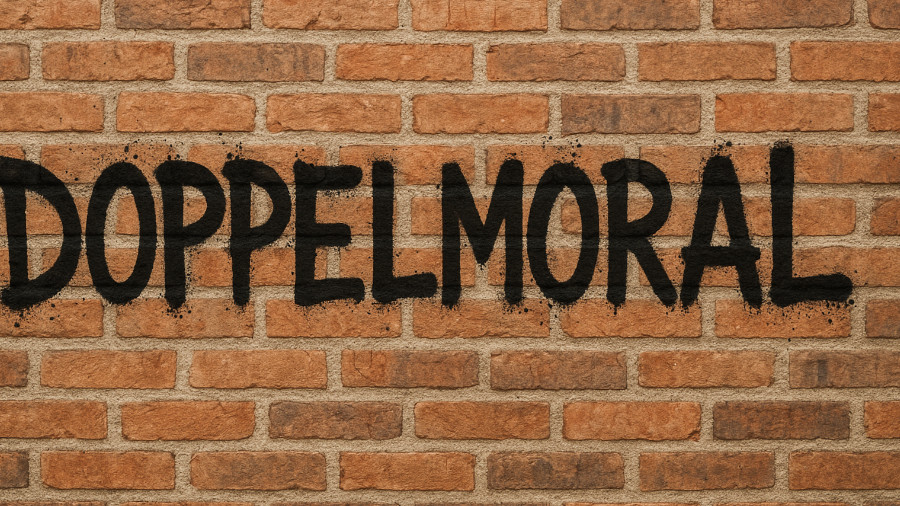
Niedergang. Wir sind mittendrin. Manche nennen diese Entwicklung ganz schlicht: Spaltung. Sonntags ist das Gegenstand in politischen Reden, dann setzt man ein Verb dran, um besorgt zu klingen: Spaltung überwinden. In den Virusjahren wurde der Begriff so richtig populär – und hat man zuvor auch stets aufs Neue diese Spaltung klein- und sie für spielerisch überwindbar schöngeredet: Während der Maskerade bekannten sich innerhalb dieser Gesellschaft viele zu dieser Spaltung – sie sollte bitte endlich vollzogen werden, denn sie sei ja nicht per se schlecht. Wer will einen entzündeten Blinddarm schon behalten? Vornehmlich irgendwelche völlig überhöhten Wichtigtuer aus dem Bezahlfernsehen sprachen auf diese Weise – Honorare auf Zwangsbeitragsbasis machen »mutig«.
Mittlerweile scheint sich dieser Niedergang verstetigt zu haben. Diese Spaltung, wie manche es nennen – oder dieser Tribalismus, wie man es auch bezeichnen könnte – jedenfalls: Die Zerstörung des gemeinsinnigen Gedankens. Denn darum geht es eigentlich. Bevor Infektionsstatistiker und Modellrechner die Exekutive übernahmen, gab es noch eine Debatte über das Schwinden des Gemeinsinns. Für Nils Heisterhagen war dies etwa das Produkt eines überschießenden Liberalismus, der Werte und Ideale überflüssig machte, indem er behauptete: Anything goes. Es zeichnete sich bereits in jenen Jahren ab, dass die Vereinzelung die Gesellschaft so sehr in Splittergruppen tranchieren wird – und heute wissen wir, die Tribalisierung hat geklappt. Kaum noch jemand will mit jemanden sprechen, der »von einem anderen Stamm« kommt. Identität nennt man das dann euphemistisch: Die Betonung des Andersseins um jeden Preis.
Whataboutism: Die Ausrede der Ertappten
Zwangsläufig generiert dies Doppelstandards. Denn so gut wie jeder diese Stämme der zeitgenössischen Bundesrepublik weiß eines ganz klar: Menschen sind nur bei uns anzutreffen – die anderen sind Barbaren, Wilde, Unmenschen, denen man die gesellschaftliche Teilhabe versagt und ja versagen muss, so sich die Gelegenheit bietet. Das beginnt so, wie Ines Schwerdtner, Fraktionsvorsitzende der Linken, neulich bei Lanzsagte: Ihre »revolutionäre Freundlichkeit« endet bei der AfD – sonst ist sie zu allen nett. Seine Freunde zu lieben: Was ist daran revolutionär? Seine Feinde zu lieben: Das wäre eine Maßnahme – und war es schon mal. Letztlich endet die Spaltung dann dort, wo neulich ein Comedian sich wie ein Scharfschütze auf die Bühne legte, an Charlie Kirk erinnerte und ein virtuelles Ziel anvisierte: Dieter Nuhr.
Ob Ines Schwerdtner jenem Comedian namens Jean-Philippe Kindler, übrigens ein Angestellter des WDR und der Linken gleichermaßen, die Freundlichkeit versagen würde? Und darf man nochmals betonen: Mitarbeiter des WDR und der Linken? Ist das die vielgelobte politische Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Anstalten? Dessen Nummer hatte weder Hand noch Fuß, was heißt, sie war nicht komisch, schien nur darauf abzuzielen, einen deutschen Charlie Kirk in den Raum werfen zu wollen – Komik setzte eigentlich mehr voraus: Es sei denn, man tritt vor ideologisch Gleichgesinnten auf, dann wird jeder inkonsistente Unsinn zu einer buchstäblichen Mordsnummer. Man lacht, weil Signalworte fallen – wie Bekiffte kichert man los, ohne ein nachvollziehbares Sujet dafür zu haben.
Schwerdtner oder Kindler als Beispiele für die Verwegenheit derer anzuführen, die sich als das bessere Gegenangebot zum vermeintlich rechtsoffenen Bürger feilbietet: In deren Blase würde man nun ausbreiten, dass dieses Vergleichen nichts anderes sei als Whatsaboutism. Doch dieser englische Begriff ist nicht mehr als lediglich die Ausrede der Ertappten. Damit ist – laut Duden – ein Diskussionsstil gemeint, »bei dem auf Argumente stets mit Gegenfragen oder einem Verweis auf andere Probleme und Themen reagiert wird«. Wer also anführt, dass jene, die von sich behaupten, sie würden stellvertretend für das Gute stehen, ebenso grotesk agieren wie jene, die als die Schlechten eingestuft wurden, der hat nur eines im Sinn: Ein Ablenkungsmanöver – eines, dass die Doppelmoral im Schilde führt und daher als Argument unbedingt ausgeschaltet werden muss. Denn das Darlegen von sogenannten Doppelstandards wird als unlauter erachtet. Als Fehlargumentation geradezu.
Doppelstandards? Eigentlich ist es viel schlimmer!
Natürlich kontern gelegentlich Menschen auch Gesagtes und Dargebrachtes mit Vergleichen, die hinken – nehmen wir nur den Hitlergruß, den man auch Leuten wie Karl Lauterbach unterstellte, weil der mal in einer seiner unsäglichen Ansprachen zur Corona-Zeit den Arm hob und das ja angeblich dasselbe sei, wie wenn ein Neonazi mit Deutschem Gruß Einzug hält. Ist es natürlich nicht, zumal Lauterbachs Arm nur auf Standbildern wie ein solcher Gruß aussah – bei aller berechtigten Kritik an den Ex-Gesundheitsminister, ein erhobener Arm macht noch keinen Hitlergrüßaugust. Aber dennoch fühlt sich für viele Menschen, auch bei schiefen Vergleichen ebenso wie bei solchen, die mit Whataboutism-Ausflüchten abgewehrt werden, etwas in Schieflage an. Ob also diese Vergleiche berechtigt sind oder hinken, spielt keine Rolle. Die Doppelmoral ist für viele Menschen fassbar und real, auch wenn sie sich gelegentlich an Vergleichen knüpfen, die fadenscheinig sind.
Die, die den Vorwürfen der Doppelmoral das Wasser abgraben wollen und die mit dem billigen Schlagwort vom Whatsaboutism hausieren gehen, um so die Belanglosigkeit eines Vergleiches zu unterstreichen, möchten partout nicht gelten lassen, dass sie Doppelstandards bedienen – sie halten das Gerede von der Doppelmoral für noch so einen rechten Clou, um dem Fortschritt im Wege zu stehen. Dabei erkennt man aber auch, dass es um die Debattenkultur noch viel schlimmer steht. Denn die Betrachtung, dass eine Doppelmoral wirkt, geht ja davon aus, dass es zwei Maßstäbe gibt, mit dem man misst. Den für die eigenen Erzählungen und Geschehnisse und jenen, den man für Erzählungen und Geschehnisse anderer Gesellschaftsgruppen verwendet. Die Gegenseite weiß also, dass es noch einen Maßstab gibt. Aber im Grunde gibt es für den Doppemoralisten diesen zweiten Maßstab gar nicht mehr – man vermisst nur noch mit jenen Maßangaben, die man für sich selbst festgelegt hat. Dass es andere Wertungen, Betrachtungen, Einschätzungen etc. gibt, die aus differenten Lebensverhältnissen und -erfahrungen resultieren, wird voll arroganter Selbstüberhöhung einfach ausgeblendet und für nichtig erklärt.
Anders gesagt: Die Doppelmoral gibt es letztlich nicht. Oder nicht mehr. Es gibt bloß noch die eine Moral, die eigene Moral, den sich selbst entworfenen ethischen Kompass, den man anwendet, um alle Menschen damit zu beglücken – oder eben zu verärgern. Dass Moral in vielen Fragen eine flexible Entität ist, die sich aus Erlebtem und Erfahrenen nährt, wäre eigentlich eine Binsenweisheit, scheint aber in diesen Zeiten nicht mehr selbstverständlich. In einigen Fragen war Moral bis zuletzt universell für alle Gruppen – etwa in der Frage, ob man Menschen töten sollte oder nicht. Wie sich an den despektierlichen Reaktionen auf die Ermordung Charlie Kirks zeigte, scheint auch diese Gewissheit in Auflösung begriffen. Nun Dieter Nuhr ins Visier zu nehmen – und sei es auch zunächst mal nur »kabarettistisch« – zeigt schon an, dass es die eine Moral auf diesem Gebiet existenziell-ethischer Fragen auch nicht mehr zu geben scheint. Denen, denen man Doppelmoral unterstellte, kann man das immer weniger nachsagen, denn sie kennen keine zwei Moralen, sie kennen nur ihre eine und eigene: Und die ist allem, jedem, immer, überall überzustülpen.

Roberto J. De Lapuente, Jahrgang 1978, ist gelernter Industriemechaniker und betrieb acht Jahre lang den Blog »ad sinistram«. Von 2017 bis 2024 war er Mitherausgeber des Blogs »neulandrebellen«. Er war Kolumnist beim »Neuen Deutschland« und schrieb regelmäßig für »Makroskop«. Seit 2022 ist er Redakteur bei »Overton Magazin«. De Lapuente hat eine erwachsene Tochter und wohnt in Frankfurt am Main.
Mehr Beiträge von Roberto De Lapuente →
Disclaimer: Berlin 24/7 bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion Berlin 24/7 widerspiegeln. Wir bemühen uns, unterschiedliche Sichtweisen von verschiedenen Autoren – auch zu den gleichen oder ähnlichen Themen – abzubilden, um weitere Betrachtungsweisen darzustellen oder zu eröffnen.







